
Führungskultur : Gewaltprävention in der Notfallmedizin
Ein Patient wartet in der Notfallmedizin der Charité Berlin auf seine Entlassungspapiere – in seinen Augen viel zu lange. Als er schließlich gehen kann, richtet er seine aufgestaute Aggression gegen eine weibliche Pflegekraft und droht: „Ich komme wieder und warte, bis deine Schicht zu Ende ist!“
So schildert PD Dr. Tobias Lindner, stellvertretender ärztlicher Leiter der Notfall- und Akutmedizin am Charité Campus Virchow-Klinikum, den Vorfall. „Das ist eine besonders perfide Form verbaler Gewalt. Die Drohung hat den Charakter des Unendlichen, die Betroffene bleibt angsterfüllt.“
Beschäftigte im Gesundheitswesen erleben besonders häufig Gewalt
Kein Einzelfall: Schon mehrfach hat Lindner verbale wie tätliche Übergriffe gegen Kolleginnen und Kollegen miterlebt, auch er selbst wurde schon angeschrien. Ein Problem, das der Mediziner mittlerweile in den Fokus seiner Arbeit gerückt hat. In seiner 2022 veröffentlichten Habilitationsschrift „Gewalt gegen in Notaufnahmen beschäftigtes Personal“ hat Lindner internationale Studien aus den 1990er-Jahren bis heute zusammengetragen.
Je nach Studie berichten 60 bis 98 Prozent der befragten Ärztinnen, Ärzte und des Pflegepersonals von verbaler Gewalt wie Bedrohungen und Beleidigungen innerhalb eines halben Jahres. Körperliche Angriffe liegen bei durchschnittlich 30 bis 50 Prozent. Ein Blick auf die Unfallanzeigen-Statistik der DGUV für das Jahr 2021 zeigt, dass Gewalt im gesamten Gesundheitssektor ein Problem ist. 6,9 Prozent der Arbeitsunfälle im Gesundheits- und Sozialwesen sind gewaltbedingt – so viele wie in keiner anderen Branche.
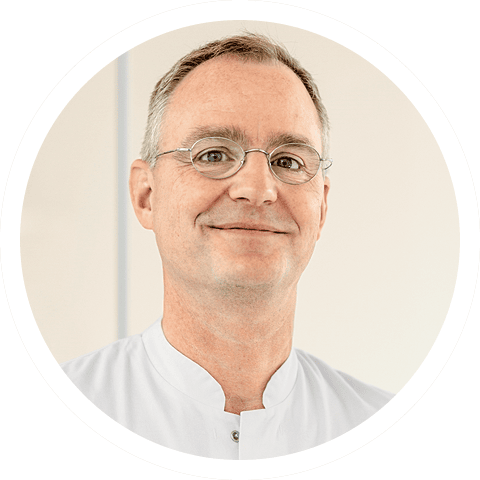
Folgen von Gewalt sind vielschichtig
Die Gründe sind vielfältig. Ein Erklärungsansatz speziell für die Notfallmedizin: „Hier arbeiten Beschäftigte oft unter Bedingungen, die eskalierendes Verhalten fördern“, so Lindner. Vor allem nachts seien viele Menschen alkoholisiert oder stünden unter Drogeneinfluss.
Aber auch Patientinnen und Patienten mit akuten Verletzungen befinden sich in einem Ausnahmezustand. Aufgebrachte, übernächtigte Angehörige können die Situation verschärfen – und sie alle sammeln sich in den häufig überfüllten Wartebereichen. Kippt die Stimmung, richtet sich die Wut oft direkt gegen die Beschäftigten.
Gewaltprävention in der Gefährdungsbeurteilung
Arbeitgebende sind verpflichtet, mithilfe der Gefährdungsbeurteilung alle Gefährdungen für Beschäftigte zu ermitteln und zu bewerten. Das gilt auch für jede Form von Gewalt. Meist wird diese Aufgabe an Führungskräfte delegiert.
- Gefährdungen durch Gewalt zu ermitteln: in Ermangelung klarer Richtwerte gilt es, die individuellen Erfahrungen der Beschäftigten zu erfragen – etwa mithilfe von Fragebögen oder in Workshops: Wer war bereits von Gewalt betroffen? Wie häufig und in welchen Situationen?
- Gefährdungen durch zu Gewalt bewerten: Risikoanalyse erstellen: Wie wahrscheinlich sind Gewalterfahrungen – und wie schwer mögliche Folgen? Daraus ergibt sich der Handlungsbedarf
- Schutzmaßnahmen ableiten: Hier gilt das TOP-Prinzip: Technische vor organisatorischen vor personenbezogenen Maßnahmen ergreifen
- Technische Maßnahmen (z. B. in Krankenhäusern): z. B. gut ausgeschilderte Fluchtwege, zugangsgesicherte Aufenthalts- und Behandlungsräume, Barrieren am Empfangstresen;
Zur Minderung von Aggressionspotenzial: z. B. angenehme Beleuchtung, vom Empfang getrennte Wartebereiche, Monitore mit Informationen zu Wartezeiten installieren - Organisatorische Maßnahmen: z. B. Wartezeitenmanagement optimieren, Sicherheitsdienst einstellen, verbindliche Verhaltensrichtlinien erstellen, Konsequenzen nach Gewaltvorfällen ziehen (z. B. Hausverbote erteilen, Schutzmaßnahmen anpassen), offene Kommunikationskultur etablieren
- Personenbezogene Maßnahmen: z. B. regelmäßig zu Schutzmaßnahmen unterweisen, Deeskalationstrainings durchführen
Gewalterfahrungen bei der Arbeit kann die Gesundheit negativ beeinflussen
Gewalt umfasst eine Bandbreite von inakzeptablen Verhaltensweisen und Praktiken oder deren Androhung, die darauf abzielen, physischen, psychischen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden zu verursachen, so die gekürzte Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). „Gewalt wird ganz subjektiv erlebt, abhängig von der Person, von der Art und der Häufigkeit. Entsprechend groß ist die Spanne möglicher gesundheitlicher Konsequenzen“, sagt Hannah Huxholl vom Referat Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren der DGUV.
„Dazu gehören Angststörungen, Depressionen oder Burn-out. Aber auch Muskel-Skelett-Erkrankungen sind typisch, wenn Menschen durch Gewalterleben dauerhaft unter Stress stehen. Chronische Erkrankungen wie Migräne können sich verschlimmern.“

Um Beschäftigte zu schützen, müssen alle Risiken durch Gewalt mithilfe der Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden. Auf Basis der Ergebnisse werden individuelle Schutzmaßnahmen zur Gewaltprävention abgeleitet. In der Charité wurde neben zugangsgesicherten Behandlungsbereichen und Sicherheitspersonal auch ein Deeskalationsmanagement etabliert.
Dafür gründeten Mitarbeitende der Charité im Jahr 2012 mit einem externen Fachpartner ein Projektteam, dem auch Tobias Lindner angehört. Alle Mitglieder absolvierten Deeskalationstrainings, um in Gefahrensituationen richtig reagieren zu können. Dieses Wissen gibt Lindner regelmäßig an sein Team weiter. Unterstützt wird das Projekt von der Unfallkasse Berlin. Eine finanzielle Förderung ist „unter bestimmten Voraussetzungen möglich“, so Alexander Ossowksi, zuständige Aufsichtsperson. Dazu gehöre ein Antrag mit einem Konzept, wie die Maßnahmen implementiert und dauerhaft umgesetzt werden. „Bei der Charité beinhaltet das Deeskalationsmanagement auch einen jährlichen Austausch mit der Unfallkasse.“ Die Unterstützung muss jährlich neu beantragt werden, betont Ossowski.
Was bedeutet Deeskalation?
Definition: Gezielt kommunizieren und intervenieren, um bei aggressivem Verhalten eine Eskalation zu vermeiden
Beinhaltet beispielsweise:
- Menschen, die offensichtlich gereizt oder unruhig sind, gezielt ansprechen und vermitteln: Ich sehe dich und dein Problem
- Immer zuerst Empathie, Verständnis und Respekt für das Gegenüber zeigen, Fragen zum Grund der Aggression stellen
- Möglichst ruhig bleiben, mit tiefer Stimme sprechen, nicht (mit-)schreien
- Selbstbewusst intervenieren, aber nicht provozieren
- Dem Gegenüber und sich selbst Zeit geben, sich zu beruhigen
- Wichtig: Die eigene Sicherheit muss im Fokus stehen!
- Daher Abstand zum Gegenüber halten, mindestens eine Armlänge
- Realistisch einschätzen: Kann die Situation allein bewältigt werden? Ist die Person überhaupt noch durch Ansprache zu erreichen? Wenn nicht: Hilfe holen und sich aus der Situation entfernen
Zum Weiterlesen: Handlungsleitfaden zur Gewaltprävention
Beschäftigte können aktiv zur Gewaltprävention beitragen
Für Mediziner Lindner war eine Erkenntnis ganz zentral: „Es muss ein Umdenken bei allen Beschäftigten stattfinden. Vielen fehlt das Bewusstsein, dass sie Teil einer eskalierenden Situation sind und diese beeinflussen können“, sagt er und gibt ein typisches Beispiel: Ein Patient wurde ins Behandlungszimmer geschickt und muss dort weiter warten. Er wird ungeduldig, stellt sich in die offene Tür, wippt mit dem Fuß.
„Dann kann ich sagen: ‚Na, wenn der so drängelt, kann er mal weiter warten.‘ Oder ich nehme mir die zwei Minuten Zeit, frage nach seinem Problem und vermittele Lösungsstrategien.“ Durch diese kurze Intervention werde vermieden, dass der Patient irgendwann das Personal anschreit, „was unsere Arbeit viel länger beeinträchtigen würde“. Kam es dennoch zu einem Übergriff, muss rasche Unterstützung erfolgen. Etwa durch betriebliche psychologische Erstbetreuende.
#GewaltAngehen: Null Toleranz bei Gewalt
Bedrohungen, Nötigung, tätliche Angriffe: Viel zu oft sind auch Einsatzkräfte betroffen. Die Kampagne #GewaltAngehen schafft Aufmerksamkeit und gibt Tipps zur Prävention.
Klicktipp: Infos und Material gibt es auf der Kampagnen-Website.
Führungskräfte müssen Betroffene aktiv unterstützen
Unerlässlich ist auch eine klare Haltung vonseiten der Führungskräfte und der Geschäftsleitung. „In der Unternehmenskultur muss ganz klar verankert werden, dass Gewalt nicht akzeptiert wird und Betroffene mit voller Unterstützung rechnen können“, sagt Hannah Huxholl. „Idealerweise wird eine gemeinsame Erklärung verfasst, die unbedingt verbindlich sein muss.“
Sprich, wenn es zu einem Übergriff kommt, müssen Konsequenzen folgen – etwa schriftliches Hausverbot für die Täterin oder den Täter. So werden Betroffene ermutigt, sich ihren Vorgesetzten anzuvertrauen. Laut Lindner ganz wichtig: „Gerade Menschen, die in ihrem Job anderen helfen, stellen die eigenen Bedürfnisse oft zurück. Sie werden beleidigt, bedroht – und melden es nicht.“ Deswegen fragt Lindner in der Teambesprechung gezielt nach solchen Vorfällen.
Jeder Übergriff wird schriftlich erfasst. Ist die betroffene Person vier oder mehr Tage arbeitsunfähig, handelt es sich um einen Arbeitsunfall, der dem zuständigen Unfallversicherungsträger gemeldet werden muss. Einen Leitsatz, den Lindner in seiner Deeskalationsschulung gelernt hat, könne er gar nicht oft genug wiederholen: „It’s not part of the job“ („Es ist nicht Teil des Jobs“)!

